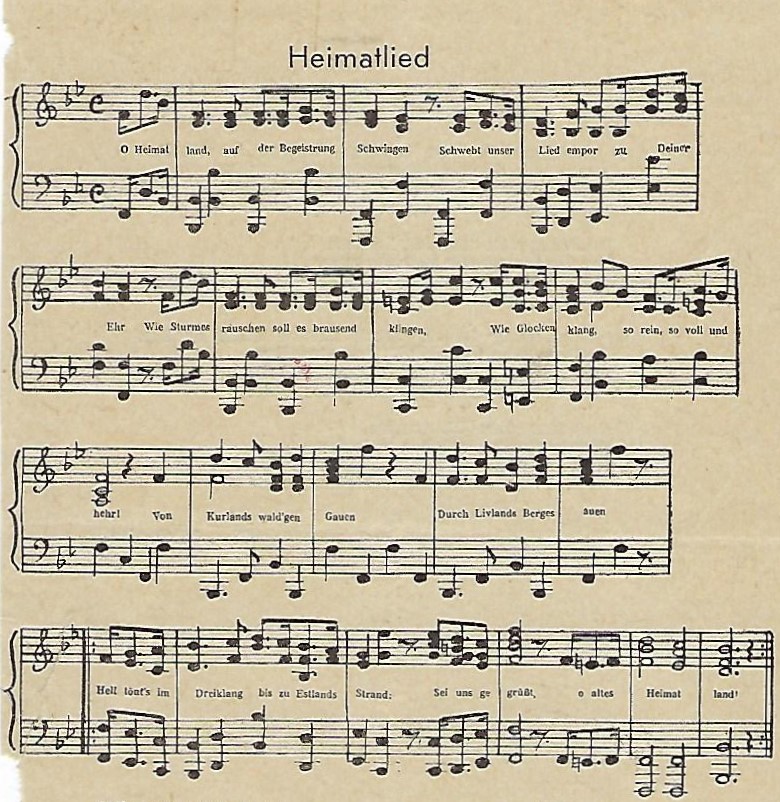von Caroline Sommerfeld
Wenn man über so verschiedene Persönlichkeiten wie Werner Bergengruen, Jakob von Uexküll, Otto Graf Lambsdorff oder Robert Gernhardt liest, sie seien Deutschbalten gewesen, ist das für die allermeisten Zeitgenossen keine Information, mit der sie irgendetwas anfangen können.
Auf der Reise nach Triest überquerten wir diesen Sommer einen Fluß in Slowenien, der meinen Mann an Ivo Andrics Roman Die Brücke über die Drina erinnerte. Unvermittelt fragte er daraufhin, ob die Drina nicht im Baltikum läge. Irgendwo im Unterbewußtsein seiner Generation lagert anscheinend noch die nebelhafte Worterinnerung an „die Düna“, die schon lange nicht mehr mit diesem, ihrem deutschen Namen benannt wird.
Deutschbalten nennt man jene Deutschen, die seit dem 12. Jh. nach Estland, Kurland und Livland gezogen sind. Vor allem der deutschsprachige Adel spielte in den folgenden Jahrhunderten eine kulturtragende Rolle in den Ostseeprovinzen des Zarenreiches. Das „Deutschbaltische“ zeichnet sich durch eine besondere Aussprache aus, die dem Schlesischen ähnelt. Der Schriftsteller Werner Bergengruen erzählte, eine seiner Tanten habe den Familiennamen beständig „Berjengrien“ ausgesprochen. Dazu kommen zahlreiche Fremd- und Lehnwörter aus slawischen Sprachen.
Historisch entstand das Deutschbaltische durch den Kontakt der mittelniederdeutschen Sprache mit Estnisch und Livisch. Erst im 18. Jh. wurde das Hochdeutsche die Sprache des dortigen Adels und damit des Handels, der Verwaltung und der evangelischen Kirche, während die einheimischen Balten sich damit schwertaten, sozial aufzusteigen, solange sie nur „Halbdeutsch“ sprachen – dortzulande auch sehr schön „Knotendeutsch“ genannt – also Mischidiome aus Deutsch und Lettisch bzw. Estnisch.
Eine gewisse Sonderlichkeit als soziales Distinktionsmittel
Heute spricht kaum noch ein Mensch in den baltischen Staaten Deutsch, wir müssen also ältere Quellen suchen. Typisch für das Deutschbalten sind die Diminutive: An viele Substantive wird das hochdeutsche „-chen“ oder das Plattdeutsche „-ing“ angehängt, sodaß Wortformen wie „Bergchen“, „Kühchen“ und „Pupping“ oder „Tochting“ zustandekommen.
Die Endungen sind durchaus eigenwillig, etwa maskulinisiert das Deutschbaltische feminine Wörter, mit Ergebnissen wie „der Sülz“ oder „der Bork“. Es bildet auch Sonderplurale wie „die Pastore“ oder „die Bröte“ – warum das geschieht, läßt sich womöglich durch die Abgelegenheit der Provinzen erklären, in welcher Idiolekte erstaunlich lange überleben, während sie in den innerdeutschen Dialektgebieten abgeschliffen werden oder Spontanbildungen sich nicht halten können. Lautlich ist neben dem russischen Zungen-R vor allem das Niederdeutsche erkennbar: So reimt sich „Schlag“ auf „nach“ und „Zug“ auf „Buch“ – das klingt etwa so, wie der Mecklenburger mit „Tach!“ grüßt.
Oskar Grosberg schrieb in seinem Roman Meschwalden. Ein altlivländischer Gutshof (1937), was ein baltischer Gutspächter von seiner Reise ins Deutsche Reich berichtet: Wie etwa seine Frau im Hotel dem Stubenmädchen sagte, sie möge doch mit einem „Spann und Luppat“ kommen, um den Kaffee von der Diele, auf die sie den Inhalt einer Tasse versehentlich gegossen, aufzunehmen, und wie das Stubenmädchen sie „wie so ’ne Dojahnsche angeschaut“ hatte und man sich mit der „Marjell“ schließlich durch Zeichen verständigen mußte: „So dumm sind die Menschen, daß sie nicht einmal ordentlich Deutsch verstehen!“
Was eine „Dojahnsche“ ist, läßt sich nur unvollständig rekonstruieren; sicher ist, daß der Nachname „Dojahn“ slawischen Ursprungs ist, vermutlich auf den tschechischen Vornamen „Dojan“ zurückgehend, der wiederum eine Koseform von „Dobromir“ darstellt, und im Zusammenstoß des Baltischen mit dem Hochdeutschen wohl dafür steht, daß das Stubenmädchen sich wie eine typische Trägerin eines slawischen Namens verhalten habe bzw. wie eine sozial niedrigstehende „Halbdeutsche“ oder gar überhaupt wie eine Russin, mit anderen Worten: für den Gutsherren ein Ausbund an Blödheit. Die Endung „-sche“ übrigens war früher überall im Deutschen gebräuchlich als Bezeichnung der Frau, etwa „die Grubersche“, „die Pollaksche“.
Daß das Deutschbalten eine Adelssprache war, merkt man ihm weder in der Phonetik noch in der Wortbildung an, denn dort ist die niederdeutsche Herkunft stark dominant – vielmehr kultivierte man wahrscheinlich eine gewisse Sonderlichkeit um ihrer selbst willen als soziales Distinktionsmittel, bis mit der Vertreibung der Deutschen auch aus dem Baltikum nach dem Zweiten Weltkrieg diese doch auch liebenswürdige Schrulligkeit ausgedient hatte.